Man unterscheidet (in Deutschland? Habe ich vor zig Jahren mal in der Berufschule gelernt) fünf Handelssorten von Gewürzpaprika, die sich im Schärfegrad unterscheiden.
Vom Mildesten zum Schärfsten:
1. Delikatess
2. Edelsüß
3. + 4. Habe ich vergessen ...
5. Rosenscharf (= der schärfste)
Der Hintergrund der Produktion der verschiedenen Sorten ist, wieviel Kerne (enthalten das Capsaicin) mit ausgemahlen werden. In der Praxis sind nur Paprika edelsüß und rosenscharf von Bedeutung, die anderen sind mir noch nie untergekommen.
Meiner Meinung nach ist eigentlich nur Paprika edelsüß von Bedeutung.
Kocht man z.B. so etwas wie einen ungarischen Gulasch, dann verwendet man am Besten edelsüßen Paprika. Denn hierbei geht es um das
Aroma des Paprikas und nicht um seine
Schärfe.
Mag man es dennoch schärfer haben, dann kann man an sich immer die "rote" Schärfe z.B. durch Peperoni oder auch Sambal Olek hinzufügen, und muss nicht immer zwei Sorten Paprikapulver bevorraten. Tabasco ist auch eine gute Alternative, allerdings ist er nicht nur scharf, sondern
pikant (pikant: die Kombination aus scharf und sauer). Das gibt den Speisen dann eine leicht säuerliche Note, schadet bei einem Gulasch aber nicht.
Man kann schon mal scharf essen, persönlich mag ich es aber nicht mehr so scharf. Denn oft schmeckt man dann nur die Schärfe und weniger den Eigengeschmack der Speisen. Außerdem vertrage ich scharfes Essen nicht unbedingt gut.
Wider besseres Wissen kann es schon vorkommen, dass ich absolut Bock auf scharfes Essen habe, Abends, nach dem 3. Bier ... um es frühmorgens darauf bitterlich zu bereuen: Dann muss ich 3x hintereinander auf "die Kapelle" rennen und erleide halbe Kreislaufzusammenbrüche und Höllenqualen der innerlichen Verbrennung, verbunden mit kalten Gesichtsschweiß ... nein, muss ich nicht haben.
Übrigens: Kocht man scharfe Gewürze kurz mit, dann ist die Verträglichkeit eine bessere ...
.





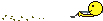

 (auf ein süffiges Alkoholreduziertes aus der Egger-Brauerei))
(auf ein süffiges Alkoholreduziertes aus der Egger-Brauerei)) 









